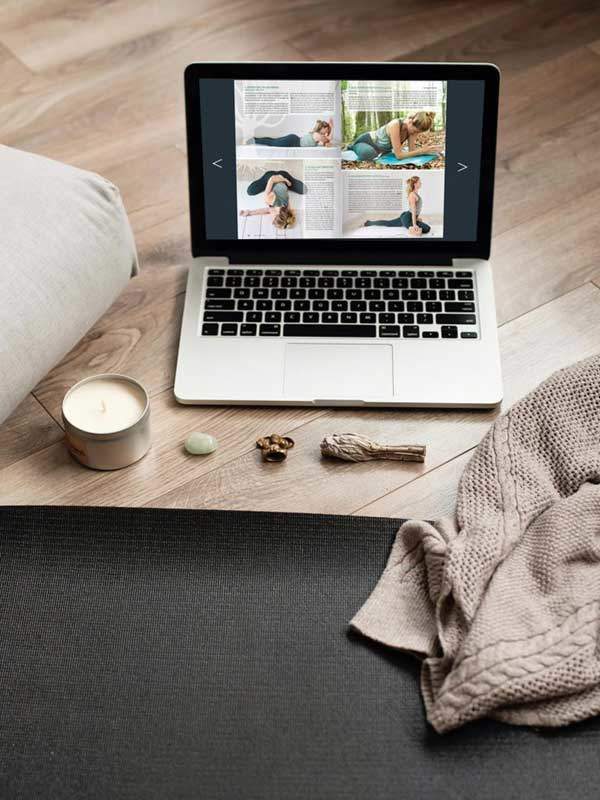Frieden im geschützten Raum des Ashrams ist leicht. Doch wie können wir ihn von dort aus in die Welt tragen – ganz konkret?
„Om Namo Narayanaya“, singt der Swami. Er sitzt vor uns im kleinen Yogaraum mit gläserner Front, deren Fenster er geöffnet hat. Wir singen es ihm nach. Wieder und wieder. Der Gesang dringt nach außen, in den Garten des Ashrams, in den warmen Sonnenschein und in den Schatten der großen Kastanie. Nach einer Weile kehrt innerhalb der Klänge Stille ein. Die Gedanken werden langsamer und weniger, bis sie schließlich ganz ruhig sind. Das Mantra für den Weltfrieden hat zu wirken begonnen. Die Welt ist jetzt ein kleines bisschen friedlicher, denn ich bin es.
Später, beim Essen auf der Wiese, berichtet eine junge Schweizerin über den Rechtsextremismus in ihrem Land. Auch die Deutschen und die Belgier können davon ein Liedchen singen. In den meisten nationalen Parlamenten Europas haben mittlerweile Parteien Einzug gehalten, die aus Fremdenfeindlichkeit Profit schlagen. Ihr Erfolg speist sich aus Wut und Angst. Uns allen scheint es an einem so friedlichen Ort surreal, dass Aggression Konjunktur hat. Hier im Ashram, wo uns jeder Mensch anlächelt und uns auf die eine oder andere Weise nah ist, können wir uns kaum vorstellen, wie viel Hass in der Welt vor sich geht. „Deshalb gehe ich jeden Tag zum Chant for Peace“, erklärt schließlich jemand. „Es reicht mir, wenn es auch nur die geringste Möglichkeit gibt, dass es Frieden bringt. Und ich chante so heftig dafür.“ Alle lachen. Doch Singen allein wird nicht helfen. Was also können wir tun?
Ahimsa von innen nach außen
„Shanti, Shanti, Shanti“ soll Frieden bringen in dir, in deinem Umfeld und in der Welt. Mit dem Frieden in uns selbst fängt es an. Um ihn zu erreichen, ist Ahimsa das oberste Gebot. Du sollst nicht schaden. Doch wie weit geht die Gewaltlosigkeit? Wie können wir durch die Welt gehen und so wenig Leid wie möglich verursachen? Vielleicht, indem wir bei uns selbst anfangen. Lange noch, bevor wir die Stimme oder die Hand erheben.
In den Gedanken fängt es an. Damit, all das Denken zu identifizieren, mit dem wir Schaden zufügen. Doch das Urteilen haben wir gelernt und verinnerlicht. Deshalb glauben wir, dass es richtig sei. Dabei liegt seine Wurzel in vergangenen Verletzungen. Solche, die uns ängstlich und traurig zurücklassen. Sie sorgen dafür, dass wir uns selbst bestärken müssen. Damit die Angst, nicht dazu zu gehören, für kurze Zeit kleiner wird. Wenn es mit uns selbst anfängt, sollten wir lernen, uns mit uns selbst zu versöhnen. Wenn man nur alle Menschen lieben kann oder keinen, sind wir selbst vielleicht unsere größte Herausforderung. Frieden mit uns selbst heißt, uns mit der Nachsicht zu behandeln, die wir auch anderen zuteilwerden lassen.
Mit unserem Umfeld geht es weiter. Mit dem Vorsatz, nicht gemein zu sein, auch nicht in Gedanken. Beim Versuch, weniger zu urteilen und mehr zu verstehen, wird das Herz spürbar weicher. Das ist hilfreich, denn mit weichem Herzen lebt es sich leichter. Und Verstehen statt Beurteilen schafft Verbindung. Selbst zum nervigen Kollegen oder der unfreundlichen Busfahrerin. Es ist die Art von Nähe, die uns nährt und die uns hilft, zu heilen. Doch ist es nicht leicht, uns selbst und unseren Mitmenschen gewaltlos zu begegnen. Denn friedlich sein heißt, keine Aggression auszuüben, auch nicht in Worten oder Gedanken, auch nicht passiv.
„Umfeld“ heißt auch: Alles, was uns umgibt. Alles, was wir berühren, worauf wir Einfluss nehmen, gestaltet die Welt. Mit diesem Bewusstsein ändern sich die Entscheidungen, die wir treffen. Denn jede einzelne Freiheit, die wir haben, bedeutet auch Verantwortung. Um uns dieser Verantwortung bewusst zu werden, müssen wir zunächst das Privileg unserer Freiheit sehen. Es ist die andere Seite der quälenden Wahlmöglichkeiten, die das Leben uns bietet und die uns manchmal lähmen.
Ändere die Welt
In der Welt soll sich der Frieden entfalten. Weil das am allerschwersten ist, braucht es dafür etwas mehr: Es braucht eine Vision, richtig groß gedacht, und einen unerschütterlichen Glauben. So, wie stabile Menschen ein Vertrauen haben in sich, in ihr Umfeld und darin, dass Gott, das Universum oder das Leben es gut mit ihnen meint. Dass am Ende alles gut wird – wo auch immer das Ende sei. Wir müssen daran glauben, dass unser Streben nicht umsonst ist. Außerdem braucht es Mut: eine Furchtlosigkeit, die Hindernisse überwindet und die auf dem Boden ebendieses Vertrauens wächst.
Ahimsa bedeutet nicht, dass wir Ungerechtigkeit teilnahmslos hinnehmen müssen. Denn auch auf friedvolle Weise können wir kämpfen. Ghandi ist dafür nur das bekannteste von unzähligen Beispielen. „Sieh Brahman [den göttlichen Urgrund] überall“, sagt unser Lehrer einige Tage später. „Schenk seinen Namen und Formen keine Beachtung.“ Brahman schließt demnach auch den „Präsidenten“ der Vereinigten Staaten ein, und auch diese rechtspopulistische Partei in Deutschland. Sie alle versuchen, ebenso wie wir, die Schmerzen ihrer Verletzungen zu lindern. Deshalb müssen wir den Zustand unserer Gesellschaft aber nicht hinnehmen, wie er ist.
Wir können informiert bleiben; nicht nur durch die Facebook-Timeline, sondern richtig informiert. Nachrichten lesen und Verantwortung übernehmen für das, was in der Welt vor sich geht. Gut informiert können wir gewaltfrei diskutieren. Wir können friedlich auf die Straße gehen oder in die Politik. Wir können anderen aufzeigen, wie eine friedliche, gerechte Ordnung aussähe. Dass all das, was uns vom Frieden abhält, nicht unabänderlich ist. Dass es nicht so bleiben muss, nur, weil es schon immer so war. Wer verzagt und aufhört, die Nachrichten zu sehen, wer sich verkriechen will in einer weichen Yoga-Wolke und verzweifelt ob all der Baustellen, wer nicht an ein gutes Ende dieser Welt glaubt, dem sei gesagt:
Wir sind friedlich. Und wir sind viele.